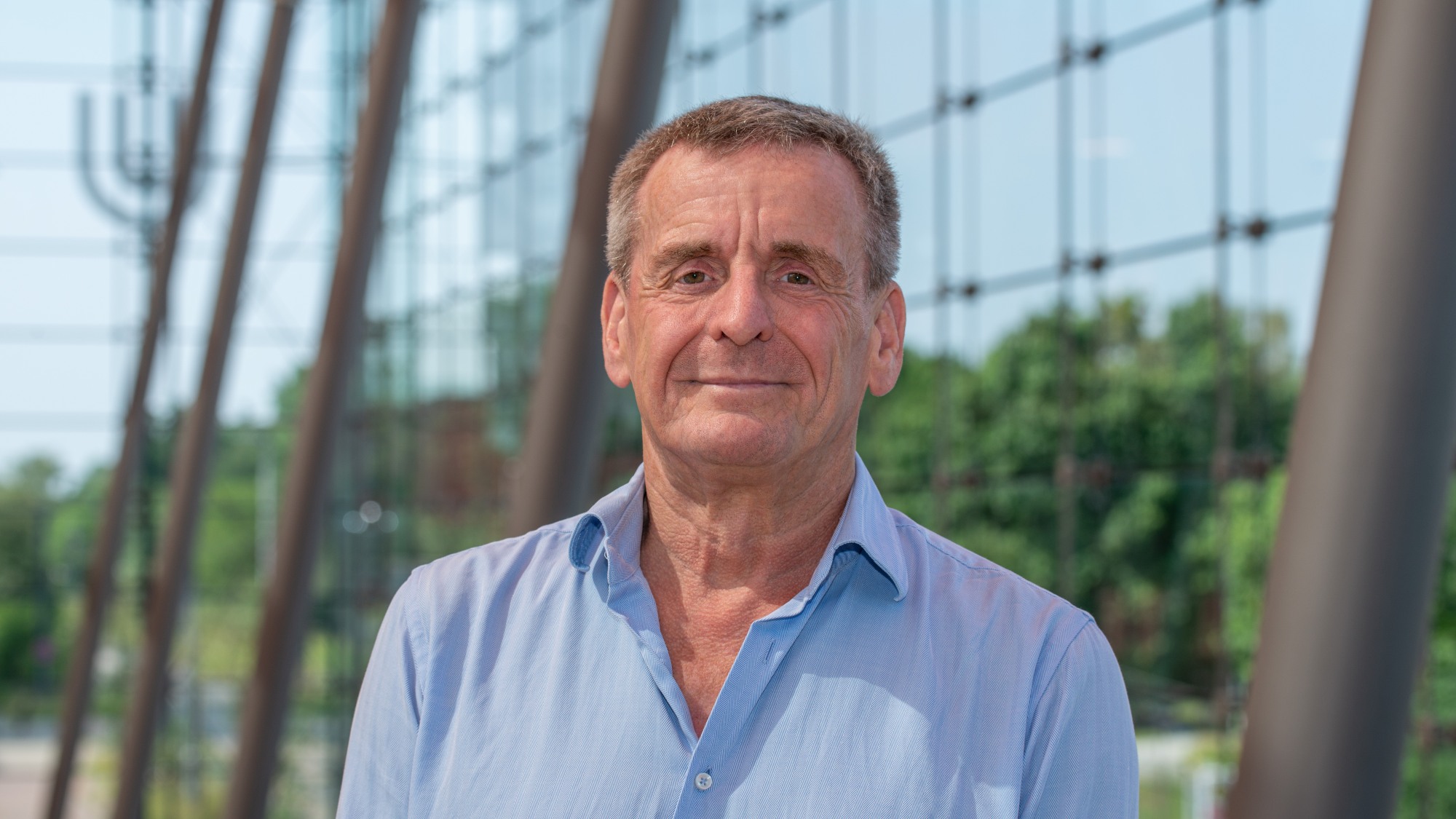
© Felix Clebowski / Universität Bremen
Demokratie auf dem Rückzug?
Ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Professor Klaus Schlichte zum Internationalen Tag der Demokratie am 15. September
Autokraten sind in vielen Weltregionen auf den Vormarsch. Zu keinem Zeitpunkt wurden in den vergangenen 20 Jahren so wenige Staaten demokratisch regiert wie heute, stellte eine Bertelsmann-Studie im vergangenen Jahr fest. Kein Grund zur Resignation, findet Klaus Schlichte, Professor für Internationale Beziehungen und Weltgesellschaft. Er ist davon überzeugt, dass die Lage nicht so hoffnungslos ist wie vielfach dargestellt.
Herr Schlichte, Sie haben für ein Fragezeichen statt eines Ausrufezeichens hinter der Überschrift „Demokratie auf dem Rückzug“ plädiert – warum?
An der Oberfläche sieht es zunächst so aus, als sei die Demokratie global auf dem Rückzug; dafür sprechen auch die Indikatoren. Wenn man aber die Perspektive langfristiger ansetzt, dann sieht alles gar nicht so verzweifelt aus. Die Demokratie hat sich nie in einer linearen Bewegung durchgesetzt, es gab immer Rückschläge und Beschleunigungen bei der Demokratisierung. Derzeit erleben wir eine Delle. Aber das ist nicht das Ende vom Lied.
Was macht Sie so sicher?
Mit Gewissheit über die Zukunft zu sprechen, ist zugegeben schwierig. Nach meiner Einschätzung hält sich der Glaube an demokratische Normen trotz autokratischer Tendenzen, etwa beim Thema „rule of law“. Dass der Staat rechenschaftspflichtig ist, dass er selber dem Gesetz und dem Recht unterliegt, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Demokratie, der sich immer mehr verbreitet und sich auch schlecht zurückschrauben lässt. Selbst Diktaturen halten Wahlen ab, sie wahren den Schein, und das ist ja auch interessant. Die Norm der Demokratie ist offenbar nicht verschwunden, wenn selbst Diktatoren auf sie reagieren müssen. Hinzu kommt ein funktionales Erfordernis. Demokratische Verhältnisse sind gekennzeichnet durch Selbstorganisation. Je mehr sich eine Gesellschaft ausdifferenziert, je komplexer sie wird, desto schwieriger wird es, sie autoritär zu kontrollieren.
Sie beschäftigen sich intensiv mit Afrika. Wie beurteilen Sie die Entwicklung dort?
Das ist schon ein Kontinent, wo man die Entdemokratisierung auch beobachten kann. Aber eben nicht auf eine Weise, dass alle demokratischen Gehalte verschwinden, wenn kein Regierungswechsel durch Wahlen stattfindet. Eben das ist mein Punkt: Weil ein autoritärer Herrscher die üblichen Wahlmechanismen aussetzt oder manipuliert, wird eine gesamte Gesellschaft nicht zwangsläufig undemokratischer.
Sie sprachen von zeitlich begrenzten Rückschlägen. Wie erklären Sie diese?
Barrington Moore, der Urvater der politischen Soziologie, hat gesagt: „no bourgeoisie, no democracy“. Wer hat die Machtmittel, um einen Staat, der vielleicht von sich aus gar nicht demokratisch sein will, dazu zu zwingen, sich zu öffnen, die Kontrolle über Ressourcen und Entscheidungen zu teilen? In der europäischen Geschichte und in der der USA war dies das Bürgertum.
Derzeit erleben wir, wie der Umbau der Gesellschaften die Mittelschichten frisst. Viele rutschen in ärmere Verhältnisse ab, eine geringere Zahl wird vermögender. Die Stimmung verschiebt sich, man geht auf diejenigen los, die nicht dazugehören oder nicht dazu gehören sollen, also auf die Minderheiten. Weil man sich durch die bisher Etablierten nicht mehr repräsentiert fühlt, wählt man die AfD. Das ist das Paradox: Der Wahlakt ist demokratisch, diese Partei ist es meiner Ansicht nach zu großen Teilen nicht. Was fehlt ist eine populäre Alternative von links, die dieses Sozialkrise und das Unwohlsein ausfüllt oder aufgreift. Das macht die Sache schon bedrohlich, da gibt es durchaus Parallelen zur Weimarer Zeit.
Viele Menschen sorgen sich angesichts dieser Entwicklungen.
Ich glaube, dass wir in unserer föderalen Demokratie deutlich besser aufgehoben sind als etwa Frankreich mit seinem zentralistischen System. Bei uns die Verfassung auszuhebeln, ist schon sehr schwierig. Wo ich ein bisschen mehr Sorge habe, ist das Feld der aktiven Politik und der Institutionen. Die Parteiendemokratie sehe ich schon in der Krise. Es ist einfach nicht wahnsinnig attraktiv, sich parteipolitisch in Deutschland zu engagieren. Und dass die Zeiten konfliktreicher werden, schriller und ruppiger, da bin ich mir auch sicher. Aber das muss nicht bedeuten, dass die Demokratie in Gefahr ist.
Wie nützlich ist ein Internationaler Tag der Demokratie?
Über Demokratie zu reden ist wichtig, ganz unabhängig von Aktionstagen. Die Politik wird nicht in den Parlamenten entschieden, es sind die Leute selbst, es ist die Alltagskultur, die darüber bestimmt, wie gut und wie stark eine Demokratie ist. Um den nicht besonders demokratischen Denker Wladimir Iljitsch Lenin zu zitieren: Die Verhaltensänderung von Millionen Menschen ist eine formidable Kraft. Wenn ich mir allerdings unseren Alltag so angucke und ihn mit der Zeit von vor 30, 40 Jahre vergleiche, dann muss ich schon sagen: ob an Universitäten, den Betrieben oder in den Familien – vieles ist demokratischer geworden.