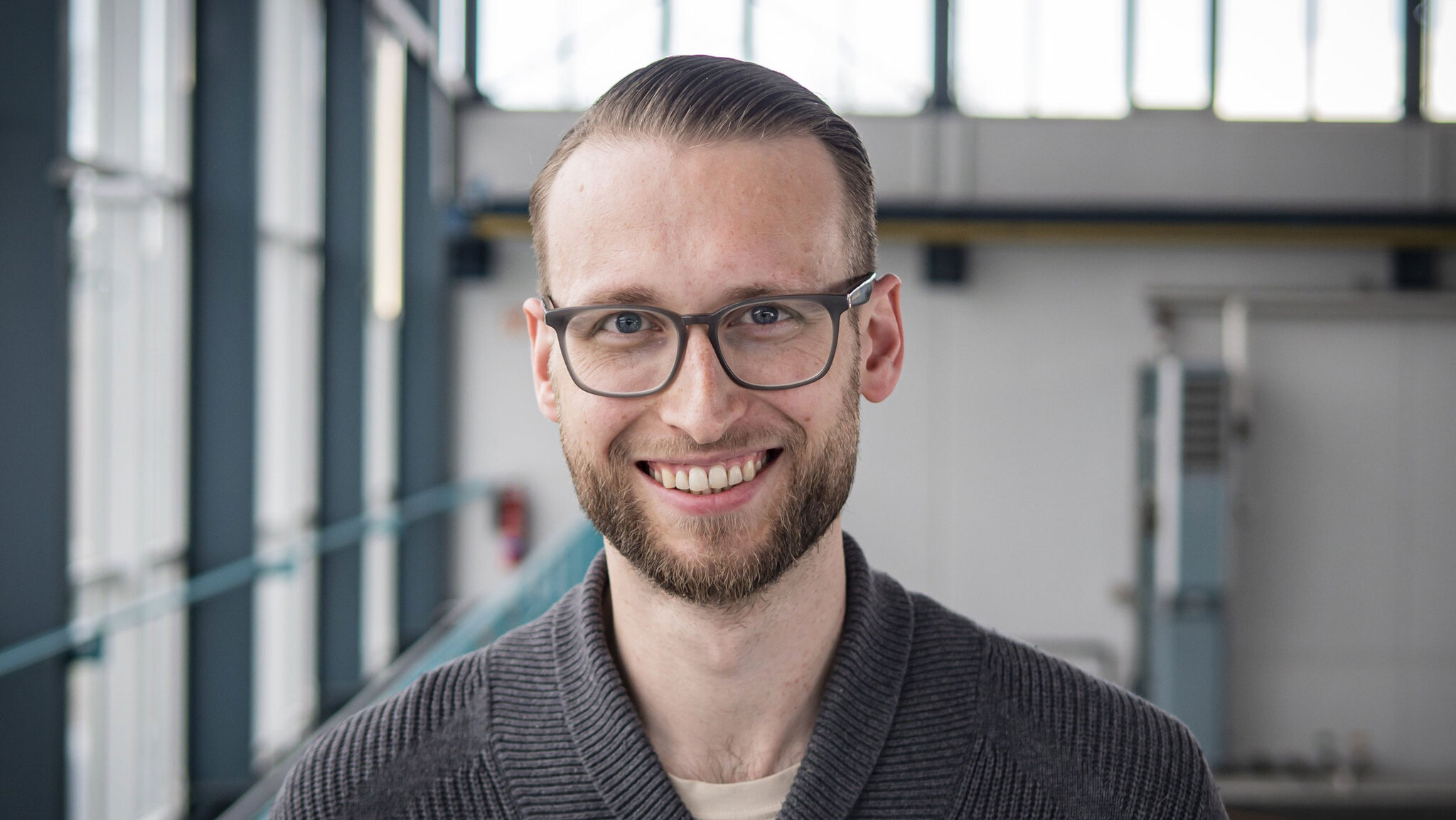
© ZARM / Universität Bremen
Wasserwirbel und andere Turbulenzen
Zwischen Cambridge und Bremen untersucht Dario Klingenberg das Chaos der Strömungen
Man kann es an jedem Bach beobachten: Wenn Wasser schnell über Hindernisse fließt, entstehen kleine oder größere Wirbel, Turbulenzen. Doch welche Formen sie genau annehmen und wie sie sich erhalten, ist komplex – so sehr, dass man es nur mit Hochleistungscomputern berechnen kann. Genau das macht Dario Klingenberg, der im Rahmen eines Programms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) an der Universität Bremen ist. up2date. hat mit ihm gesprochen.
Erst Darmstadt, dann Cambridge, jetzt Bremen – Sie haben schon an vielen Orten geforscht. Wie ist es dazu gekommen?
Nach meiner Promotion an der Technischen Universität Darmstadt hatte ich Lust, im Ausland zu forschen, und dafür hat sich das Programm „Postdoctoral Researchers International Mobility Experience“ des DAAD angeboten. Die Idee dahinter ist, dass man anderthalb Jahre an verschiedenen Institutionen verbringt – zwölf Monate an einer Hochschule im Ausland und dann noch mal sechs Monate in Deutschland. Für meinen Auslandsaufenthalt habe ich mir die Universität Cambridge ausgesucht. Die hat nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht gut zu meiner Forschung gepasst, sondern Cambridge ist auch allgemein ein spannender Ort mit einer langen Wissenschaftstradition. Im März 2025 bin ich dann an die Universität Bremen gekommen. Hier profitiere ich stark von dem Austausch mit dem Leiter des ZARM Marc Avila und anderen Forschenden, die sich mit Strömungen und Turbulenz beschäftigen.
Bei Turbulenzen denken wahrscheinlich viele an ihren letzten Urlaubsflug. Was versteht man aber aus physikalischer Sicht darunter?
Angenommen, Sie beobachten Wasser, das durch ein Rohr fließt, und Sie färben einen kleinen Tropfen ein, um seine Bewegung zu verfolgen. Wenn die Flüssigkeit langsam fließt, ist der Weg des Tropfens vorhersehbar: geradeaus, parallel zur Wand. Aber wenn die Flüssigkeit schneller fließt, entstehen Verwirbelungen – und plötzlich lässt sich kaum noch vorhersagen, welchen Weg der Tropfen nehmen wird. Das ist Turbulenz im physikalischen Sinne.
Das ist leicht zu verstehen – aber schwer zu erforschen?
Genau, und dieser Kontrast macht das Thema für mich so faszinierend. Die Grundprinzipien von Turbulenz sind schon seit 150 Jahren bekannt, aber erst moderne Methoden machen es möglich, sie wirklich zu verstehen. Hier kommt nämlich die Chaostheorie ins Spiel. Sie besagt, dass selbst winzige Unterschiede im Anfangszustand eines Systems einen riesigen Unterschied machen können. Solche kleinen Unterschiede lassen sich in der Realität nie vollständig vermeiden. So ist es zu erklären, dass bei chaotischen Systemen selbst das – scheinbar – gleiche Experiment bei jeder Wiederholung völlig unterschiedliche Ergebnisse liefern kann. Wenn Wasser zum Beispiel über ein kleines Hindernis fließt, kann es je nach Geschwindigkeit oder Form des Hindernisses ganz unterschiedlich reagieren: Mal bildet es ruhige Wirbel, mal bricht es plötzlich in wildes Chaos aus. Schon kleinste Veränderungen – ein bisschen mehr oder weniger Geschwindigkeit, ein etwas anderer Winkel, und eben auch unkontrollierbare Unterschiede in den Umgebungsbedingungen, können das gesamte Verhalten der Strömung verändern.
Wie kann man dennoch turbulente Strömungen vorhersagen?
Dafür nutzt man meistens hochleistungsfähige Rechencluster, also Zusammenschlüsse vieler einzelner Computer, die parallel arbeiten. Seit einiger Zeit werden auch verstärkt Grafikkarten verwendet – so auch in meiner Forschung. Mit den Computern simuliere ich sogenannte Kanalströmungen, bei denen Wasser durch den Spalt zwischen zwei unendlich ausgedehnten Platten fließt. Ich möchte herausfinden, was Turbulenz am Leben erhält, warum sie sie also unter bestimmten Bedingungen aufrechterhalten wird und unter anderen nicht. Übrigens sind meine Erkenntnisse auch auf andere Gebiete übertragbar, denn Strömungen von Flüssigkeiten wie Wasser und Gasen verhalten sich aus mathematischer Sicht gleich.
Wofür könnte Ihre Forschung einmal nützlich sein?
Zuerst einmal handelt es sich um Grundlagenforschung, sie ist aber dennoch nicht weit von Anwendungen entfernt, zum Beispiel bei der Konstruktion von Flugzeugen oder Schiffen. Da hilft ein besseres Verständnis von Turbulenz dabei, kraftstoffsparende Bauteile zu konstruieren. Aber auch bei der Wettervorhersage oder der Optimierung von Rohrleitungen spielt Turbulenz eine zentrale Rolle. Turbulenz ist eben nicht nur sehr anschaulich, sondern auch weit verbreitet – und genau das macht sie für mich zu so einem faszinierenden Forschungsgebiet.
Weitere Informationen
Zum Förderprogramm „Postdoctoral Researchers International Mobility Experience“ (PRIME) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)